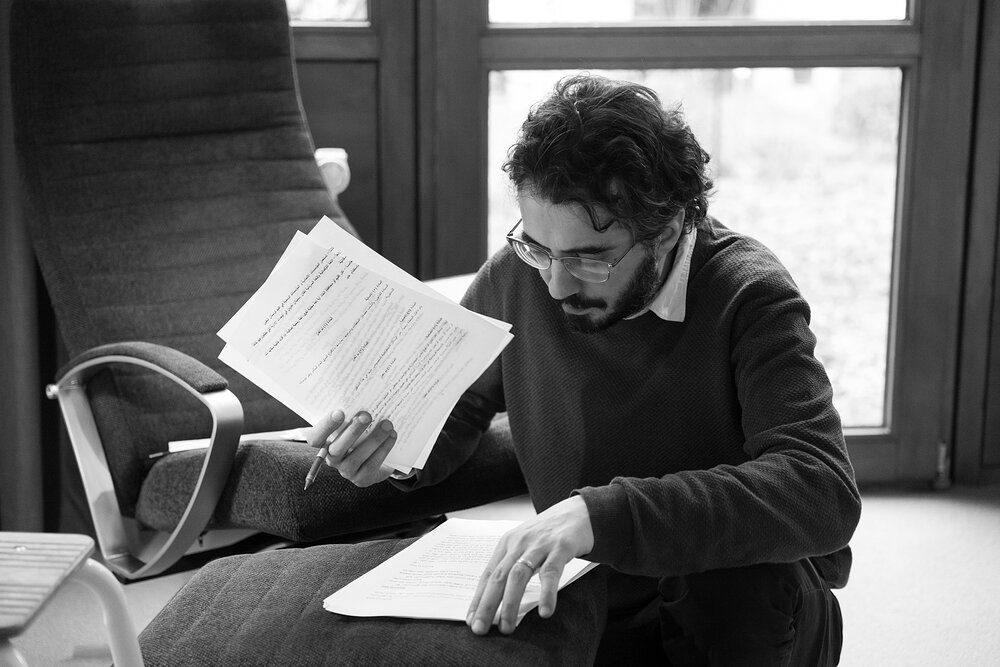Ausgabe 15 / Mai 2020
„Jedes Gespräch bietet eine Chance“
Katja Gelinsky
Sachlicher Optimismus ist die Grundstimmung Zaid Al-Alis. Der Verfassungsrechtler beobachtet die politischen Entwicklungen der Länder des Nahen Ostens seit Jahren und legt die jeweils individuelle Situation der einzelnen Nationen in der Krisenregion offen
Katja Gelinsky: Die arabische Protestbewegung hat beginnend im Jahr 2011 verfassungsrechtliche Reformprozesse in nahezu einem Dutzend Ländern in der Region angestoßen. Als Berater für Verfassungsrecht haben Sie in fast allen dieser Staaten die Ausarbeitung neuer oder veränderter Verfassungen begleitet. Wie kam es dazu?
Zaid Al-Ali: Vielleicht fange ich ganz von vorn an: Meine Familie kommt aus dem Irak, aber ich bin in Madrid geboren. Schon als Kind habe ich in verschiedenen Ländern gelebt. Auch meine juristische Tätigkeit war von Anfang an stark international geprägt. Zunächst habe ich für eine internationale Anwaltskanzlei in Paris, London und New York gearbeitet. 2005 ging ich als Rechtsberater der Vereinten Nationen in den Irak, wo nach dem Sturz Saddam Husseins eine neue Verfassung erarbeitet wurde. In dieser Zeit habe ich viel zum Verfassungsrecht im Irak publiziert und etliche Kontakte geknüpft. Als der Arabische Frühling 2011 begann, wurde ich von verschiedenen Seiten angesprochen, ob ich arabische Länder unterstützen könne, die nach den Protesten verfassungsrechtliche Änderungen vornehmen wollten. Ich habe mich dann entschieden, für das International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) zu arbeiten, eine zwischenstaatliche Organisation zur Demokratieförderung mit Hauptsitz in Stockholm. Für IDEA zog ich nach Kairo, wo eine nationale Debatte darüber geführt wurde, wie die ägyptische Verfassung verbessert werden solle. Tunesien besuchte ich ebenfalls häufig, um die über die dortigen Verfassungsänderungen beratenden Gremien zu treffen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass sich durch meine Veröffentlichungen und Beratungen sowie Medienauftritte ein Netzwerk ergeben hat, das nach und nach immer mehr arabische Länder einschloss.
KG: Verfassungsreformen sind ja eine politisch sensible Angelegenheit, vor allem, wenn ihnen Aufstände vorausgingen. Vermutlich war es gar nicht so einfach, Zugang zu den Verhandlungen zu bekommen?
ZAA: Das war von Land zu Land sehr unterschiedlich. Bei den ägyptischen Machthabern herrscht traditionell großes Misstrauen gegenüber Ausländern. Das bekam ich auch zu spüren. Als Nichtägypter durfte ich nicht unmittelbar bei den Verfassungsberatungen dabei sein. Ich habe dann Hintergrundgespräche mit vielen Beteiligten geführt. In anderen Ländern, in Tunesien zum Beispiel, saß ich dagegen mit am Verhandlungstisch. Auch im Jemen war das der Fall. Insgesamt waren meine Begegnungen sehr vielfältig: Ich habe Regierungsvertreter beraten, Beamte, die die Verfassungstexte ausgearbeitet haben, Repräsentanten der verschiedenen politischen Parteien, aber auch Vertreter der Zivilgesellschaft und Journalisten.
KG: Welche Erwartungen hat die Bevölkerung in den Ländern des Arabischen Frühlings mit verfassungsrechtlichen Reformen verbunden?
ZAA: Allgemein kann man sagen, dass für die Menschen das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern im Vordergrund stand. Zentral für die Bevölkerung war der Schutz grundlegender Rechte, an erster Stelle natürlich der Schutz der Menschenwürde. In vielen arabischen Ländern spielen zudem sozioökonomische Rechte eine wichtige Rolle für das Verfassungsverständnis der Menschen. Vom Staat wird erwartet, dass er für eine angemessene Gesundheitsversorgung und Bildung und für relativ gute Arbeitsmöglichkeiten sorgt.
KG: Wie wichtig waren den Menschen Demokratiefragen?
ZAA: Das lässt sich nicht so leicht sagen. Nicht alle, die gegen die damals Regierenden protestierten, gingen auf die Straße, weil sie glühende Verfechter der Demokratie sind. Für viele Menschen in arabischen Ländern ist Demokratie in erster Linie ein Instrument im Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft. Mit Demokratie verbinden sie die Hoffnung, die eigene sozioökonomische Lage zu verbessern. Sicherlich gibt es auch die Überzeugung, dass Demokratie ein Wert an sich ist, ebenso wie die umgekehrte Ansicht, dass Demokratie prinzipiell abzulehnen ist.
KG: Und welche Rolle spielte der Schutz von Minderheiten in den Verfassungsverhandlungen?
ZAA: Minderheitenrechte sind vor allem in den Ländern ein Thema, in denen relativ große Gruppen religiöser Minderheiten leben, etwa im Irak und Libanon oder in Ägypten. Tunesien dagegen ist religiös betrachtet sehr homogen. Im Irak und Libanon genießen Religionsgemeinschaften eigene politische Rechte – anders dagegen in Ägypten. In der dortigen Verfassung findet sich zu wenig zu Rechten der christlichen Minderheit. Theoretisch folgt Ägypten in etwa dem französischen Staatsmodell, man unterscheidet also nicht zwischen einem christlichen und einem muslimischen Staatsbürger. Zivilrechtlich, etwa im Familien- oder Erbrecht, gelten jedoch durchaus unterschiedliche Gesetze für die verschiedenen Religionsgruppen.
KG: Da wir schon beim Thema Recht und Religion sind: Welche Bedeutung hatte die Scharia, die Grundlage der islamischen Ge- und Verbote, für die Verfassungsarbeiten?
ZAA: Scharia, Demokratie und Rechtsstaat bilden einen schwierigen Gesamtkomplex in nahezu allen Ländern des Arabischen Frühlings. Die Menschen sind damals auf die Straße gegangen, weil sie keine Zukunftschancen sahen. Politisch haben von den Aufständen aber vor allem die islamistischen Organisationen profitiert, obwohl sie die Proteste nicht anführten und die Bevölkerung auch nicht unterstützten. Aber die islamistischen Akteure waren am besten organisiert. Sie wollten die Gelegenheit nutzen, die Scharia zur Grundlage des Rechtssystems zu machen. Das hat zu erheblichen Spannungen geführt. Bei den Wahlen in Tunesien 2011 erreichte die islamistische Partei zwar knapp 40 Prozent, aber die anderen Parteien, so zerstritten sie auch sonst waren, wollten keinen islamischen Staat etablieren. In Ägypten war die Scharia bereits Teil des geltenden Rechts und die Muslimbruderschaft, damals die politische Mehrheit, wollte sie zum maßgeblichen Gesetz erklären. Mit dem Sturz der Muslimbrüder hat das ägyptische Militär diesen Schritt aber wieder rückgängig gemacht. Insgesamt kann man sagen, dass die Versuche, arabischen Verfassungen nach dem Arabischen Frühling die Scharia zugrunde zu legen, vorerst gescheitert sind. Aber das heißt nicht, dass der Kampf um die Scharia zu Ende ist. Man wird sehen, wie es weitergeht.
KG: Auch wenn die Verfechter der Scharia sich nicht durchsetzen konnten, weisen Sie darauf hin, dass es letztlich die Eliten waren, die die Verfassungsreformen in ihrem Sinne und damit zu ihrem Vorteil gestalteten und dabei die Bedürfnisse der Bevölkerung weitgehend ignorierten. Wie ist das möglich, nachdem die Konstitutionalisierungsprozesse doch durch die Proteste der Bevölkerung in Gang gesetzt worden waren?
ZAA: Das hat verschiedene Gründe. Verfassungsverhandlungen sind schon ihrem Charakter nach Elitenprojekte, die größere Bevölkerung hat nur selten Gelegenheit, daran teilzunehmen. Hinzu kommt die Furcht vor Veränderungen, die gerade in den konservativen arabischen Gesellschaften sehr stark ausgeprägt ist. Die Menschen waren und sind unzufrieden, aber sie scheuen die Ungewissheit des Neuen. Man darf auch nicht vergessen, dass der Arabische Frühling ein sehr spontanes Ereignis war. Es gab keine Pläne, wie es danach weitergehen sollte. Auch fehlten Strukturen, auf denen die Aufständischen aufbauen konnten. Unter den repressiven Regierungen, die damals herrschten, war es nicht möglich, sich entsprechend zu organisieren. Deshalb ist es so wichtig, dass nun Basisarbeit geleistet wird, indem wir Gespräche und Diskussionen führen. Das ist im Wesentlichen das, was ich derzeit mache – Anregungen geben und Unterstützung leisten, damit die Menschen in der Region ihre eigenen Ideen entwickeln, was sie erreichen möchten, wenn sich das nächste Mal die Gelegenheit zu Reformen bietet.
KG: Wo sehen Sie die besten Chancen für eine positive Entwicklung?
ZAA: Meist wird aus guten Gründen Tunesien genannt. Die Bedingungen dort sind gut, weil es keine gewaltsamen Konflikte wie in Libyen, im Jemen oder im Irak gibt. Hinzu kommt, dass Tunesien sein politisches System infolge des Arabischen Frühlings tatsächlich von Grund auf geändert und demokratische Strukturen geschaffen hat. Auch das Führungspersonal wurde ausgetauscht. In Ägypten dagegen ist vieles beim Alten geblieben. Die politische Macht ist immer noch beim Präsidenten konzentriert, das Parlament hat nur wenig Einfluss und die Gerichte stehen weitgehend unter der Kontrolle der Regierung. Auch sind die reaktionären islamischen Kräfte in Ägypten weit stärker als in Tunesien, wo es ein deutlich breiter gefächertes politisches Spektrum gibt, was zur Verständigung und zum Ausgleich maßgeblich beitrug. Das hat sich auch positiv auf die Reform des Justizwesens ausgewirkt. Einen ganz großen Fortschritt sehe ich vor allem darin, dass Tunesien als erstes Land in der Region das Verhältnismäßigkeitsprinzip in seiner Verfassung verankert hat. Vorbild dafür war übrigens auch die deutsche Rechtsprechung.
KG: In Ländern wie Libyen und dem Jemen gab es ebenfalls Pläne für neue Verfassungen. Nun herrschen dort gewaltsame Machtkämpfe. Sind diese eine Folge verfehlter Verfassungsverhandlungen oder sind die Verfassungsreformen Opfer der Gewalt?
ZAA: Beides spielt ineinander. In beiden Ländern begannen die gewalttätigen Konflikte bereits, bevor die Verfassungspläne scheiterten. Aber das Scheitern setzte dann eine neue Spirale der Gewalt in Gang. Ich war 2014 im Jemen als Berater an den Verfassungsverhandlungen beteiligt. Die Huthi-Rebellen eroberten während dieses Prozesses immer mehr Gebiete. Als sie 2015 die Regierung stürzten, erklärten sie die Verfassungsarbeiten für beendet. Das konnte kaum verwundern, da die Huthi nicht beteiligt gewesen waren und ihre Interessen keine Berücksichtigung fanden. In Libyen dagegen lagen die Verfassungsarbeiten zwar in den Händen gewählter Volksvertreter. Aber auch das war problematisch, da Mitglieder politischer Parteien sich nicht zur Wahl stellen durften. Grund dafür war das Misstrauen gegen politische Parteien, das noch ein Erbe der Gaddafi-Diktatur war. Die Mitglieder des Verfassungsgremiums hatten jedoch nicht den Rückhalt derjenigen, die in Libyen Macht und Einfluss ausübten. Die Verhandlungen fanden völlig abgekoppelt davon statt, dass Milizenführer weite Teile des Landes kontrollierten. Das konnte nicht funktionieren. Wieso sollten die Milizenführer die Verfassungspläne eines machtlosen Gremiums akzeptieren?
KG: Sowohl im Jemen als auch in Libyen unterstützten die Vereinten Nationen die Reformbemühungen. Was sagt die negative Entwicklung in beiden Ländern über die Rolle und den Einfluss internationaler Berater auf Konstitutionalisierungsprozesse in der arabischen Region aus?
ZAA: Ich würde nicht pauschal von einem Versagen der Vereinten Nationen sprechen. Im Jemen drohte schon 2011 ein Bürgerkrieg. Dass es damals nicht dazu kam, ist nach überwiegender Ansicht das Verdienst der Vereinten Nationen, namentlich von Jamal Benomar, dem damaligen UN-Sondergesandten im Jemen. Er war zunächst so beliebt, dass jemenitische Eltern ihre Kinder nach ihm benannten. In den Jahren 2014 und 2015 hingegen konnte Benomar den Ausbruch des Bürgerkrieges nicht mehr verhindern. Wenn eine der Konfliktparteien nicht verhandlungswillig ist, sind auch die Vereinten Nationen machtlos. Gleichwohl ist der jeweilige Sondergesandte schon eine Schlüsselfigur, weil er die Strategie der Vereinten Nationen bei dem Versuch, den Konflikt zu lösen, festlegt. 2011 und 2012 war der Sondergesandte für Libyen der Brite Ian Martin. Er agierte nach dem Arabischen Frühling sehr zurückhaltend. So leisteten die UN 2012 zur Vorbereitung der ersten Wahlen nach dem Sturz Gaddafis nur technische, nicht aber politische Unterstützung, um den Libyern Raum für ihren eigenen Weg demokratischer Gestaltung zu lassen. Wie gesagt, der jeweilige UN-Sondergesandte bestimmt in sehr weitem Maße, wie die UN in dem jeweiligen Land vorgehen. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie schwerwiegend die Folgen verfehlter Hilfsbemühungen sein können, nicht nur für das jeweilige Land, sondern für die gesamte Region. Noch problematischer wird es, wenn man sich anschaut, wie jemand UN-Sondergesandter wird. Es gibt kein öffentliches Auswahlverfahren, um den besten Kandidaten zu finden, sondern der UN-Generalsekretär ernennt jemanden, der für die Aufgabe zur Verfügung steht. Manchmal sind das Personen, die zwar breite internationale Erfahrung haben, aber weder die Landessprache sprechen noch die Region besonders gut kennen.
KG: Was können denn ausländische Berater nach Umbrüchen wie dem Arabischen Frühling bestenfalls leisten?
ZAA: Sie können helfen, Perspektiven zu entwickeln. Je mehr Ideen in die Reformprozesse einfließen, desto besser. Natürlich kommt es auch darauf an, wie die jeweiligen Beraterinnen und Berater ihre Aufgabe verstehen. Ich habe ausländische Experten erlebt, die extrem gut vorbereitet waren und in den Verhandlungen sehr sensibel agierten. Zuweilen gibt es aber auch Ausländer, die offenkundig keine Ahnung haben und dennoch meinen, die Reformer vor Ort belehren zu müssen. Im Jemen gab es beispielsweise jemanden, der sich nicht einmal die Mühe gemacht hatte, vor Beratungsbeginn den Verfassungsentwurf zu lesen.
KG: Was sollten ausländische Berater beherzigen, wenn sie verfassungsrechtliche Erneuerungsprozesse in arabischen Ländern flankieren?
ZAA: Es empfiehlt sich nicht, mit fertigen Konzepten im Gepäck anzureisen. Zunächst sollte man die Gesprächspartner vor Ort nach deren Vorstellungen und Bedürfnissen fragen. Welcher Informationsbedarf besteht überhaupt? Idealerweise sollten sich Berater auf ein längerfristiges Engagement einstellen und sich an die zehn- bis zwanzigmal mit den dortigen Beteiligten treffen. Irgendwann ist es dann auch möglich, brauchbare Handlungsempfehlungen zu geben. Aber anfangs hat man als Ausländer schlichtweg keine Ahnung. Deshalb wäre es auch völlig verfehlt, gleich beim ersten Treffen mit Ratschlägen vorzupreschen. Viele ausländische Berater unterschätzen auch, wie viel verfassungsrechtliche Expertise es in den arabischen Ländern gibt, etwa zu Fragen der Regierungsorganisation, des Parlamentarismus oder richterlicher Kontrolle.
KG: Apropos, wie hat sich der Arabische Frühling eigentlich auf die Gerichtssysteme ausgewirkt?
ZAA: Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Die Richterschaft in der Region war Teil der Unterdrückungsregime. Diktatoren mögen keine unabhängig denkenden, klugen Richter. Es gab deshalb keinerlei Anreize für fähige junge Leute, sich für den Richterberuf zu entscheiden, zumal das Jurastudium sich in monotonem Pauken erschöpfte. Analyse und kritisches Hinterfragen gehörten nicht dazu. Beides war später in der Richterausbildung auch nicht gefragt. So hat sich über die Jahrzehnte eine Justizkultur tiefen Misstrauens gegen all jene entwickelt, die das Herrschaftssystem infrage stellten oder verdächtig waren, gegen dessen Regeln zu verstoßen. Die Richter verstanden sich also als Beschützer der staatlichen Ordnung. Trotz der Aufstände sind diese konservativen Strukturen überwiegend erhalten geblieben. Wohlmeinende Fachleute aus dem Ausland wiesen in den Verfassungsberatungen dann darauf hin, wie wichtig es sei, die Unabhängigkeit der Justiz zu sichern. Das Problem war jedoch, dass eine Kultur richterlicher Unabhängigkeit nicht existierte. Indem man institutionelle Vorkehrungen schuf, die Richterschaft vor Einflussnahme zu schützen, wurde also faktisch die einseitige richterliche Parteinahme für die Regierenden zementiert. Selbst in Tunesien gibt es trotz des grundlegenden Umbaus des Gerichtswesens weiterhin starke Beharrungskräfte. Manche tunesischen Richter ignorieren schlichtweg, dass sie nunmehr verfassungsrechtlich verpflichtet sind, die Rechte jedes Einzelnen zu schützen und das Verhältnismäßigkeitsprinzip anzuwenden. Eine der großen Herausforderungen arabischer Länder besteht also darin, die Rolle der Richterschaft neu zu definieren. Damit das geschieht, muss der Bevölkerung jedoch zunächst bewusst werden, dass die Ungerechtigkeit und Benachteiligung, die sie in ihren Ländern erfahren, auch damit zu tun hat, dass die Richter nicht im Namen des Volkes Recht sprechen. Es ist also ein Bewusstseinswandel nötig. Hinzukommen müssen personelle Erneuerungen in der Justiz und strukturelle Reformen, um den Missbrauch richterlicher Unabhängigkeit zu verhindern und Fehlverhalten zu ahnden. Es nützt nichts, nur die Verfassungen zu reformieren. Man braucht einen Wandel der Rechtskultur. Ohne ihn bleiben die Reformen wirkungslos.
KG: Obwohl die Konstitutionalisierungsprozesse nach dem Arabischen Frühling insgesamt so wenig erfolgreich verlaufen sind, wirken Sie nicht entmutigt oder verbittert. Oder täuscht dieser Eindruck?
ZAA: Nein, ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Dinge ändern werden, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das noch erleben werde. Aber wir leben nicht mehr in Zeiten, in denen eine Führungsfigur auftaucht, die alles ändert. Wir müssen beharrlich in kleinen Schritten arbeiten. Dazu gehört auch, dass man sich der Begrenztheit der eigenen Rolle bewusst ist. Wenn ich komplett versage, wird es andere geben, die weitermachen. Jedes Gespräch bietet die Chance, jemanden zu überzeugen, dass die arabischen Länder sich reformieren müssen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass es gar nicht so schwierig ist, diese kleinen Erfolge zu erreichen, die sich dann summieren werden.
Mehr zu: Zaid Al-Ali
Fotos: © Maurice Weiss